lumophon: Drahtpotentiometer 1MOhm?
lumophon: Drahtpotentiometer 1MOhm?

Beim Restaurieren des Gerätes entdeckte ich ein kleines Drahtpotentiometer -

Das könnte der übliche "Entbrummer" sein - war mein erster Gedanke.
Beim Verfolgen der Schaltung merkte ich aber: das kann nicht sein, das müsste der Lautstärkeregler sein.
Hm, ein Drahtpoti - sicher so um die 100Ω - wie soll das denn gehen? Da hat einer etwas verbastelt.
Also ausbauen.
Da musste ich verblüfft feststellen, dieser vermeintliche "Entbrummer" hat einen Widerstand von fast 1,5MΩ und noch dazu logarithmisch!!
Nun habe ich aber ein Problem. Wie geht das? Wo ist das "Geheimnis" dieses Lautstärkereglers mit dickem Widerstandsdraht und über 1MΩ von 1929?
Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Da alles gut "verpackt" ist, könnte ich auch meine Neugierde nur durch "zerlegende" Prüfung befriedigen.
Wer weiß was dazu?
Wolfgang Eckardt
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

in einem russischen Buch über Schaltzeichen habe ich eine erklärende Zeichnung gefunden. Den Text habe ich uns erspart.
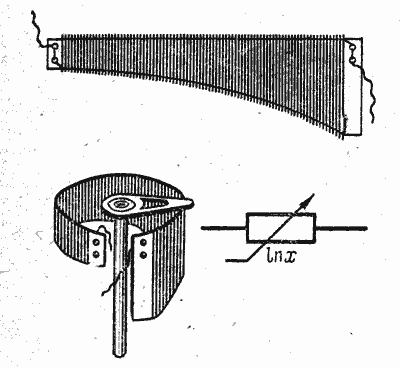
(Quelle: В. В. Фролов, Язык Радиосхем)
Der hohe Widerstand ist zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
===================================
Ein anderer Drahtpotenziometer ist mir für die Regelung der Steuergitterspannung von alten Neuberger-Röhrenprüfgeräten begegnet. Dieser hat auch die äussere Bauform Ihres Exemplars. Die Besonderheit liegt darin, dass er je zur Hälfte mit unterschiedlichem Konstantandraht gewickelt ist. Die beiden Wicklungen bestehen aus 300Ω + 2700Ω. Als Spannungsteiler soll er von 0–5V regeln und dann von 5–50V.
Viele Grüße, H.-T. Schmidt
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
Hallo Herr Eckardt,
für einen Widerstand von 1MOhm ist der Draht mit Sicherheit zu dick. Ich kann mir vorstellen, dass die Drähte nur einen Verschleißschutz darstellen und den Kontakt zu einer darunterliegenden Kohleschicht herstellen. Messen Sie doch bitte mal den Widerstand von Windung zu Windung und als Vergleich vom Anfang zu Ende einer Windung (soweit wie möglich mit Tastspitze an dem Punkt, wo der Draht wieder verschwindet). Wenn die zweite Messung 0 Ohm ergibt, liege ich richtig.
Beste Grüße, Gerald Gauert
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
Rätsel gelöst

Zuerst einmal Dank den Schreibern von Mails und Beiträgen im Thread. Aber so richtig kamen wir noch nicht an die Lösung, wobei Herr Gauert der Sache schon näher kam.
Das geht aber gaaanz anders:
Nach der Demontage des Potis und gründlicher Untersuchung mit Lupe und Ohmmeter machte ich die Feststellung, dass
1. der aufgewickelte Draht nur aus Messing (Weißmessing) besteht, also in keinerlei Zusammenhang mit dem Widerstandswert steht. Er dient, so wie Herr Gauert schon vermutete, nur als Kontaktbrücke zur eigentlichen Widerstandsbahn.
2. zwei benachbarte Windungen haben am Anfang und am Ende des Körpers mit den Drahtwindungen praktisch Null Ohm, nach der Mitte zu ergeben sich aber Werte im 100-Ohm-Bereich bis zum "mehrere Kiloohm-Bereich".
Die Sache wurde immer merkwürdiger.
3. Um die Drahtwindungen (1) herum liegt ein schwarzes Band (2) aus Kunststoff? Karton?, alles zusammengehalten von einem Außenring (3) - siehe Bild 1:

Im Detail betrachtet sieht das so aus: 
Jetzt kam schon die Vermutung, dieses schwarze Band zwischen Drahtwindungen und Außenring müsste der Träger einer Widerstandsbahn sein (woraus?). Aber dann müssten ja die Drahtwindungen als ständiger "Kurzschluss" dieser Widerstandsbahn wirken. - Also auf zur restlichen Demontage.
Ja, und dann kam des Rätsels Lösung zum Vorschein:

Die Vermutung mit der Widerstandsbahn auf dem schwarzen Kunststoffstreifen war also richtig und die Drahtwindungen waren jeweils nach der 16. Windungen an Anfang und Ende der Ringbahn aufgetrennt, um einen Durchgang durch den fast "widerstandslosen" Messingdraht zu verhindern!
Die aufgetrennten Drahtwindungen kontaktieren also kontinuierlich die Widerstandsbahn (man sieht sogar die Abdrücke der einzelnen Drahtwindungen auf der Widerstandsbahn) und gleichzeitig dienen sie als Kontaktgeber für den üblichen Schleifer. Dadurch wird jeglicher Verschleiß auf der Widerstandsbahn beim drehen am Poti vermieden.
Sooo einfach ist das!
War 'ne spannende Sache.
Wolfgang Eckardt
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
Hochohm-Poti

Hallo Herr Eckardt,
wirklich eine Spannende Geschichte - hier nur noch zur Ergänzung aus:
"Neuester Illustrierter Radio-Katalog 1928/1929"
der Firma Radio-Diehr / Berlin

Der Preis lag 1928/29 bei 3,40 RM.
Herzliche Grüße
Hilmer Grunert
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
Eine moderne Form

Auch heute werden immer noch Potentiometer nach ähnlichem Prinzip hergestellt wenn es darum geht eine ganz spezielle und präzise Kennlinie herzustellen.

Das Potentiometer besteht aus einer mit Kupfer beschichteten und anschließend geätzten Keramikträgerplatte, die auf ein verzinktes Stahlblech geklebt ist. Über die Leiterbahnstrukturen der Keramikträgerplatte ist eine sehr harte und verschleißfeste Widerstandsschleifbahn aufgedampft. Diese Widerstandsbahn hat ganz bewusst einen viel höheren Widerstand als gewünscht. Der richtige Widerstandwert wird durch Parallelschalten einer ebenfalls aufgedampften, niederohmigen Widerstandskette erreicht, die der Schleifbahn richtige Werte aufprägt. Hierfür sind eigens dünne Leiterbahnen bis unter die Schleifbahn geführt. Die parallele Widerstandskette wird mit einem Laser abgeglichen, was an den Einschnitten in den Widerständen zu erkennen ist. Auf diese Weise kann ein Poti mit fast beliebiger Kennlinie hergestellt werden. So ein Poti kann natürlich nur als Spannungsteiler an einem sehr hochohmigen Verstärkereingang verwendet werden, da es sonst zu Spannungsfällen zwischen den Anschlusspunkten der Parallelwiderstände innerhalb der Schleifbahn kommt.
Gruß Dieter
Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.